Forschung
Promotionsprojekt: Konfliktaustragung im norddeutschen Raum des 14. und 15. Jahrhunderts. Untersuchungen zu Fehdewesen und Tagfahrt
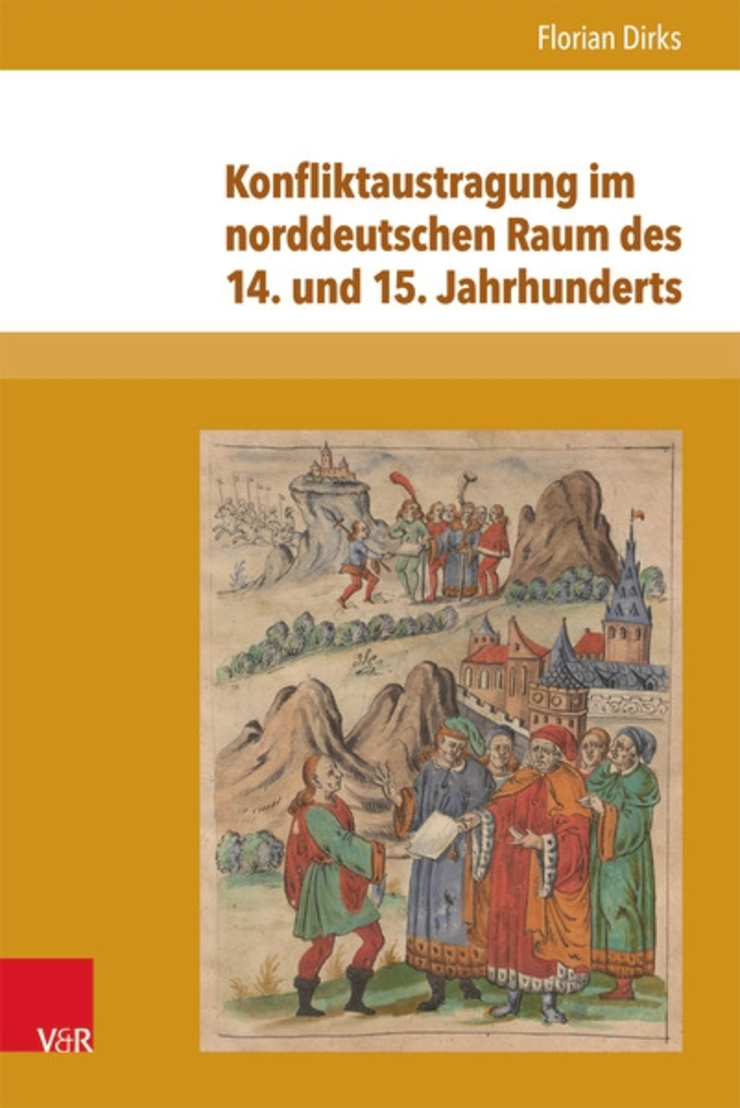
In der Dissertation wird das Vorgehen Adliger bei Konflikten mit ihres gleichen und mit Städten untersucht. Dabei steht vornehmlich das Konfliktmanagement mittels der sogenannten Tagfahrt im Mittelpunkt der Studien. Was taten die Fehdegegner im 14. und 15. Jahrhundert, vor allem im norddeutschen Raum, um ihre einmal begonnenen Feindseligkeiten wieder beizulegen? Wie sahen mögliche Schritte der Deeskalation und der Schaffung von Frieden aus? Im Gegensatz zur Forschung zu den Land- und Gottesfrieden steht dabei nicht das präventive Element im Zentrum, sondern verschiedene Möglichkeiten und Versuche einer gütlichen Beilegung bereits laufender Auseinandersetzungen. Das bisherige Bild der Forschung, das eine zunehmende Beeinflussung der Konfliktführung durch rechtliche Elemente, wie den Anspruch der Kaiser und Landesherren auf eine allgemeine Stärkung des Schiedsgerichtes, konstatiert, vernachlässigt überwiegend das Element der Verhandlungsführung.
Die Studie untersucht mehrere Fallbeispiele von Fehden, in denen Tagfahrten für die Beilegung der Auseinandersetzungen eine große Rolle spielten. Die Erkenntnisse aus diesen Fallbeispielen werden dann unter verschiedenen Gesichtspunkten, vor allem auf Tagfahrten fokussiert, verglichen.
Durch einen solchen Vergleich wird nicht nur Fehde als Begriff und Sache zur Diskussion gestellt, sondern auch Kommunikationspraktiken der unterschiedlich verfassten Akteure analysiert, die bis hin zu „Kommunikation unter Anwesenden“ auf Tagfahrten reichen.
Bearbeiter: Florian Dirks
Promotionsprojekt: Mittelalterliche Klein- und Kleinststädte im nördlichen Thüringer Becken. Ein Vergleich ihrer Entstehung und Entwicklung
In den letzten Jahrzehnten hat sich die deutsche Städteforschung verstärkt den kleineren Städten und ihrer Rolle in den jeweiligen Räumen zugewandt. Gerade der thüringische Raum ist vor allem durch seine Vielzahl an Klein- und Kleinststädten geprägt, welche zum Teil sehr dicht nebeneinander liegen. Dieser Umstand macht die Städtelandschaft in Thüringen nahezu einzigartig.
Im Forschungsprojekt soll deshalb an fünf ausgewählten Beispielen untersucht werden, wie sich die jeweiligen Orte zu Städten entwickeln konnten und welche Funktion sie im zentralörtlichen Gefüge wahrnahmen. Ausgewählt wurden dafür die im nordwestlichen Thüringer Becken liegenden Städte Thamsbrück, Bad Langensalza, Bad Tennstedt und Schlotheim sowie der im Mittelalter als Dorf, Flecken und Stadt bezeichnete Ort Herbsleben. Zunächst sind an Hand eines Fragenkataloges alle fünf Orte in Einzeluntersuchungen zu bearbeiten. In einem zweiten Schritt sollen dann die Ergebnisse vergleichend betrachtet werden. Ziel ist es dabei, zu überprüfen, ob, wie die Forschung durchaus meint, die kleineren Städte maßgeblich aus territorialpolitischen und militärstrategischen Gesichtspunkten angelegt worden sind und sie deshalb kaum oder nur rudimentäre städtische Strukturen ausgebildet haben.
Die hierfür ausgewählten Orte sind in ihrem Status als Stadt nicht gleich, sondern befinden sich auf „verschiedenen Stufen von Stadt.“ Auf der untersten Ebene ist der von Zeitgenossen als Dorf, Flecken oder Stadt bezeichnete Ort Herbsleben anzusiedeln. Ob es sich hierbei um eine städtische Kümmerform handelt, wird zu überprüfen sein. Eine Stufe höher stehen dann die Gründungsstädte Thamsbrück und Schlotheim. Bei diesen ist zu untersuchen, inwiefern hier der durchaus in die Kritik gekommene Begriff Minderstadt anzuwenden ist oder nicht besser der neutralere Begriff Kleinststadt benutzt werden sollte. Auf der obersten Stufe, stehen die Städte Bad Tennstedt und Bad Langensalza, wobei der letztere Ort noch einmal eine günstigere Entwicklung nahm und neben der Reichsstadt Mühlhausen in der Region ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum war.
Bearbeiter: Sven Leininger
Promotionsprojekt: Dem Seelenheil verpflichtet. Gründung und Förderung von Klöstern im Spätmittelalter am Beispiel der Herren von Lobdeburg
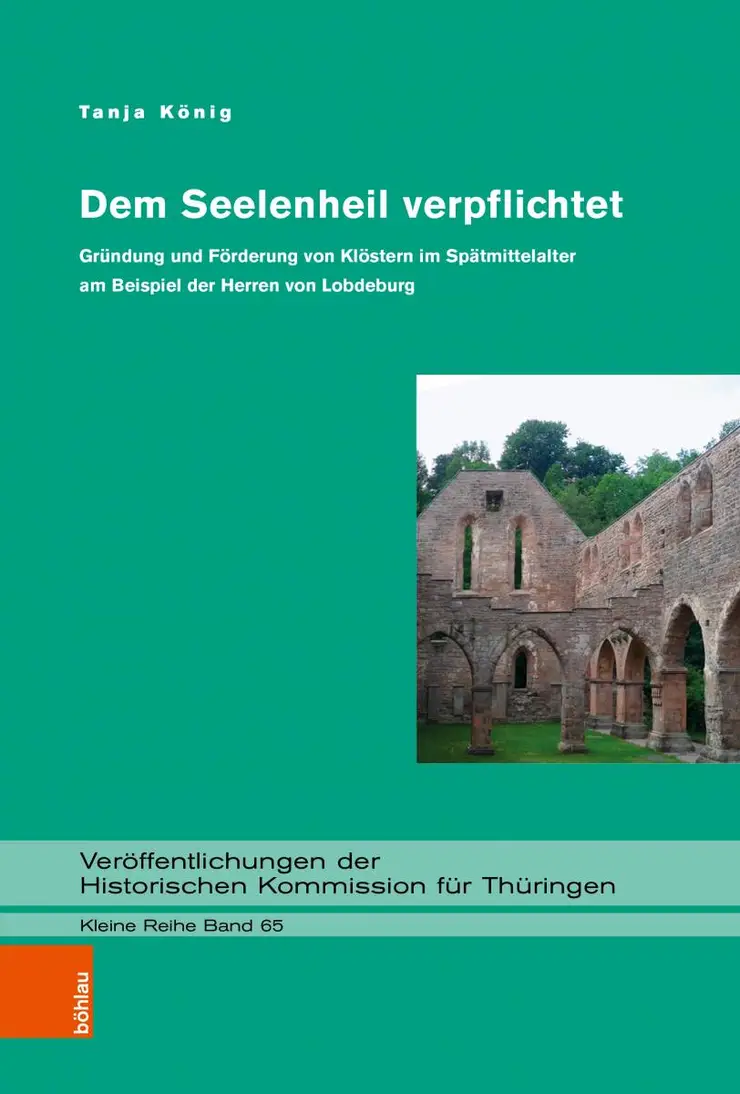
Im Mittelpunkt stehen der Aufstieg des Hauses Lobdeburg und das religiöse Engagement der Familie, die sich sowohl in der Gründung und Förderung von Klöstern als auch durch die Inanspruchnahme des Bischofsamtes von Würzburg erkennen lassen. Das Geschlecht der Herren von Lobdeburg ist urkundlich seit dem 12. Jahrhundert belegt, als sie sich von Franken in den thüringischen Raum begaben und dort ihren Herrschaftsmittelpunkt errichteten. Der Zeitrahmen ist daher vom 12. Jahrhundert bis zum Aussterben des Adelsgeschlechtes im 15. Jahrhundert abgesteckt. Im Hinblick auf die Gründung und Förderung monastischer Institutionen ist nach der Motivation und den Gründen für die Wahl der Klöster und deren Orten zu fragen. Ebenso wird nach Kriterien zu suchen sein, die das religiöse Engagement der Adelsfamilie beeinflussten.
Die lobdeburgische Klosterlandschaft soll als Konstrukt betrachtet werden. Visualisiert durch ein Netzwerkmodell soll unter anderem aufgezeigt werden, wie intensiv Vertreter des Adelsgeschlechtes in Kontakt mit gegründeten und/oder geförderten Konventen standen, in welcher Art und Weise sie miteinander verflochten waren und welche Motive vordergründig erschienen, um die Verbindung aufrecht zu halten.
Das Buch ist zu finden unter: König, Tanja: Dem Seelenheil verpflichtet. Gründung und Förderung von Klöstern im Spätmittelalter am Beispiel der Herren von Lobdeburg (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, Köln 2022).
Bearbeiter/in: Dr.Tanja König
Promotionsprojekt: Durch Worte kämpfen. Konfessionelle Polemik monotheistischer Religionen am Beispiel des Christentums (16.-17. Jahrhundert)
Schriftliche Auseinandersetzungen zwischen Gelehrten seit der Reformation waren oftmals durch hitzige Wortgefechte gekennzeichnet. Thema waren die Andersgläubigen, Personen oder Gruppen, die nicht nach den gängigen Regeln der jeweiligen Religionsgemeinschaft lebten. Ketzer, Häretiker und Ungläubige waren Bezeichnungen, die in Polemiken nicht nur für Juden und Muslime galten, sondern auch für die katholische Kirche, die Lutheraner oder die Reformierten. Mit der Reformation verschob sich der Wortgebrauch. Die Auseinandersetzungen zwischen den Gelehrten wurden härter und personifizierter.
Ziel des Dissertationsprojektes ist es, anhand von polemischen (Druck-)Schriften und Predigten christlicher Gelehrter zu untersuchen, inwieweit sie durch sprachliche Benennung andere religiöse Gruppen charakterisierten und stigmatisierten. Auf Grundlage von Judith Butlers Theorie der „Hate speech“, welche besagt, dass Sprache durch eine eigene Handlungsmacht verletzen kann, wird untersucht, inwieweit die Benennungen und Stigmata verletzende Wirkung hatten. Dies soll anhand der Rezeptionsgeschichte der verwendeten Begrifflichkeiten näher erforscht werden. Hierbei spielt vor allem auch die Eigenwahrnehmung von Öffentlichkeit der jeweiligen Autoren hinsichtlich ihrer Schriften eine wichtige Rolle.
Um nachzuvollziehen, ob es Veränderungen in der Begriffsverwendung und –wahrnehmung gab, ist es wichtig, die Untersuchung bereits vor der Reformation anzusetzen, weshalb das Projekt schriftlichen Kontroversen in der Zeit vom 14. bis zum 18. Jahrhundert untersucht.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Bearbeitung: Anne Weinbrecht
DFG-Projekt: Der König als Teil des Netzwerks. Herrschaftspraxis unter Wenzel IV. (1361-1419) in Böhmen und im Reich
Das Projekt untersucht, wie Herrschaft zur Zeit König Wenzels IV. funktionierte. Die fast durchgehend negative Bewertung dieses Herrschers sowohl durch die zeitgenössische Historiographie als auch durch die moderne Forschung brachte ihm den Beinamen "der Faule" ein. Auf der anderen Seite herrschte er 22 Jahre lang über das römisch-deutsche Reich und über 40 Jahre als böhmischer König. Die langen Regierungszeiten zeigen, dass er Wege gefunden haben muss, seine Herrschaft durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Diese Wege sollen im Projekt vor allem anhand des erhaltenen Urkundenmaterials nachvollzogen und analysiert werden.
Projektleitung und -bearbeitung: Dr. Christian Oertel

