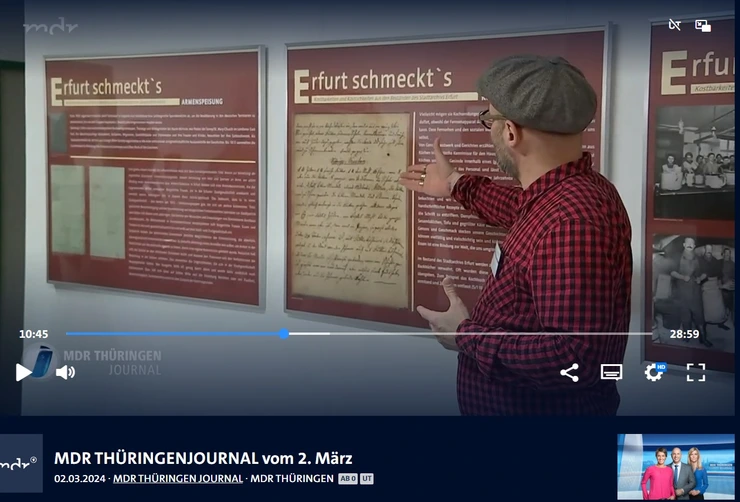Monografien
Schwarz, Angela/Stahl, Heiner: Kontaktzone Bonn. Das Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit (1949-1969), Göttingen: Wallstein, 2023.
(Rezension) Jan Ruhkopf: Rezension zu: Schwarz, Angela; Stahl, Heiner: Kontaktzone Bonn. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit 1949–1969. Göttingen 2023 , ISBN 978-3-8353-5373-2, In: H-Soz-Kult, 23.08.2024, <www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-137796>.
Stahl, Heiner: Geräuschkulissen, Hörwissen und soziale Akustik in Erfurt, Birmingham und Essen (1880-1960), Köln: Böhlau, 2022.
(Rezension) Wagner, Helen: Rezension Geräuschkulissen, in: WerkstattGeschichte Nr. 91 (März 2025) 1, S. 154-157, https://werkstattgeschichte.de/wp-content/uploads/2025/03/WG91_154-157_Wagner_zu_Stahl.pdf.
(Rezension) Ziemer, Hansjakob: Rezension zu: Heiner Stahl: Geräuschkulissen. Soziale Akustik und Hörwissen in Erfurt, Birmingham und Essen (1880-1960), Köln / Weimar / Wien: Böhlau 2022, in: sehepunkte 23 (2023), Nr. 6 [15.06.2023], http://www.sehepunkte.de/2023/06/37778.html.
Schmolinsky, Sabine/Hitzke, Diana Hitzke/Stahl, Stahl (Hg.): Taktungen und Rhythmen. Raumzeitliche Perspektiven interdisziplinär, Berlin: DeGruyter, 2018.
(Rezension) Frank Reichherzer, Rezension zu: Schmolinsky, Sabine; Hitzke, Diana; Stahl, Heiner (Hrsg.): Taktungen und Rhythmen. Raumzeitliche Perspektiven interdisziplinär. Berlin 2018, ISBN 978-3-11-045548-9, In: H-Soz-Kult, 30.01.2020, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-28671.
Stahl, Heiner: Jugendradio im Kalten Ätherkrieg. Berlin als eine Klanglandschaft des Pop (1962-1973), Berlin: Landbeck 2010.
(Rezension) Menzel, Rebecca: Rezension zu: Stahl, Heiner: Jugendradio im kalten Ätherkrieg. Berlin als eine Klanglandschaft des Pop 1962-1973. Berlin 2010, ISBN 978-3-9811375-8-3, In: H-Soz-Kult, 29.11.2012, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-15693.
Englisch-Sprachige Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden (2010-2024)
2024
Stahl, Heiner: Acoustic Lanes and Auditory Leads. Spatio-Temporalities of Social Acoustics and Public Address Systems in Late Weimar Germany, in: Art Style | Art & Culture International Magazine Vol. 13 (2024), No. 13, S. 71-82. DOI: 10.5281/zenodo.10443405.
2023
Stahl, Heiner: Flavours of frozen ice cream around 1800. Gustatory knowledge, courtly pastry craft and cookbooks, In: Christina Bartz/Jens Ruchatz/Eva Wattolik (eds.): Food-Media-Senses, Bielefeld: transcript, 2023, S. 105-121.
2022
Stahl, Heiner: Sensing noise, sensing space. Environmental perceptions and the impact on future urban space in Germany and the United Kingdom (1900-1930), In: Christoph Schliephake/Evi Zemanek (eds.): Anticipatory Environmental (Hi)Stories: Narratives of Coming Nature(s) from Antiquity to the Anthropocene, Lanham, MY, Lexington, 2022, 2, S. 171-190.
2016
Stahl, Heiner: Mash-Up the Sound of the City. Exploring 'acoustic spaces' in 1960s West Germany. When underground pop literature merges with New Journalism, In: Marcel Broersma/Frank Harbers (eds.): 'Witnessing 1960s'. A Decade of Change in Journalism and Literature, Leeuven : Peeters, 2016, S. 169-184. https://doi.org/10.5281/zenodo.11370332
2014
Stahl, Heiner: Sounding out Erfurt. Does the Song Remain the Same? In: Carrie Smith-Prei/Gwyneth Cliver (eds.): Bloom and Bust. Urban Landscapes in the East since German Reunification, New York : Berghahn, 2014, S. 151-185.
Stahl, Heiner: Auditory Traces of Subcultural Practices in 1960s Berlin. A Border-Crossing Soundscape of Pop, In: Sheila Whiteley/Jedediah Sklower (eds.): Popular Music & Countercultures, London : Ashgate, 2014, S. 223-235.
2013
Stahl, Heiner: Preparing for Landing, Ready for Take-Off. Zoning Noise Pollution as Spatio-Temporal Practices at Berlin-Tegel and Berlin-Tempelhof Airport (1965-1975), In: Historical Social Research 38 (2013) H. 3, S. 229-245.
2011
Stahl, Heiner: Foley Artistry - Wiring acoustic spaces of cinema, television, and radio play, In: Nico Carpentier, Ilija Tomanić Trivundža (eds.): ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, Tartu 2011, S. 193-200. URL: http://www.researchingcommunication.eu/reco_book7.pdf
2010
Stahl, Heiner: Listening to the Sound of Radio. Applying an auditory perspective to Media and Communication Studies, In: Nico Carpentier, Ilija Tomanić Trivundža (eds.):Media and communication studies interventions and intersections. 2010 ECREA Summer School, Tartu : Tartu University Press 2010, S. 51-60. URL: http://www.researchingcommunication.eu/reco_book6.pdf
Stahl, Heiner: Mediascape and Soundscape in Cold War Berlin, In: Philipp Broadbent/ Sabine Hake (eds.): Berlin. Divided City, 1945-1989. New York : Berghahn 2010, S. 56-66.
Aufsätze in Sammelbänden und Journals
2024
Stahl, Heiner: Standardising news and serialising recipes. Frames in the printing industry (1770-1800), in: On-Culture, Issue #Frames#, Electronic Journal, GCSC / International Graduate Centre for the Study of Culture, [Abstract angenommen]
Stahl, Heiner: Artisten der Verlautbarung. Günter Diehl und Gustav Adolf Sonnenhol als Öffentlichkeitsarbeiter im Dienst für das nationalsozialistische Regime und die Bundesrepublik Deutschland (1935-1969), In: Norman Domeier/Benno Nietzel (Hg.): Nationalsozialismus und internationale Öffentlichkeit, Berlin 2024. [im Druck]
Stahl, Heiner: Veilchenaroma: Blumenduft und der Geschmack von gefrorenem Nachtisch in Kochbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts, In: Magdalena Eriksroed-Burger/Barbara Denicolò (Hg.): Eggenburger Tage der Kochkultur 2023, Eggenburg 2024. [eingereicht]
Stahl, Heiner: Belastete Republik Deutschland. Praktiken staatlicher Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik in Rundfunk und Fernsehen seitens des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (1949-1969), In: Gertrude Cepl-Kaufmann et al. (Hg.), Die Bonner Republik Bd. 3, Bielefeld transcript, 2024. [Text angenommen]
2023
Stahl, Heiner: Geräusche und Geschmack stecken in Akten : ein Werkstattbericht über Sinneswahrnehmungen auf ungeduldigem Papier, in: Archive in Thüringen. Mitteilungsblatt 2023, Erfurt/Jena 2023, S. 18-20. https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_01339979
Stahl, Heiner: Der Osten: Von Gegenwartsbezeichnungen und Verortungen der Vergangenheit. Die Medienerzählungen westdeutscher Fernsehanstalten in den 1960er Jahren, in: Rundfunk und Geschichte 49 (2023), H. 3–4, S. 48-61.
Stahl, Heiner: Ernst Haeckel – Medienstar. Popularisierungen von (Natur-) Wissenschaft in den Massenmedien Buch und Zeitschrift 1891 bis 1910, In: NAL-historica, Nr. 84 (2023), S. 33-51.
2022
Stahl, Heiner: Eisgenuss und Hupgeräusche. Sinneswissen und -praktiken in städtischen Raumordnungen (1900-1930), In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OeZG) (Ellinor Forster/Regina Thumser-Wöhs (Hg.)), Sinnesräume, 33. Jg, (2022), 2, S. 96-117.
2021
Hauptstock, Hans/Stahl, Heiner: Akustische Raumordnungen des A-Falls. Reichslautsprechersäulen im Nationalsozialismus, In: Rundfunk und Geschichte 47 (2021), 1-2, S. 11-22.
2020
Stahl, Heiner: Staatliche Öffentlichkeitsarbeit und publizistische Reklame für die Bundesrepublik Deutschland in Afrika und Asien (1953-1960), In: Frank Becker/Darius Harwardt/Michael Wala (Hg.): Die Verortung der Bundesrepublik. Ideen und Symbole politischer Geografie nach 1945, Bielefeld, 2020, S. 89-110.
Stahl, Heiner: Gisela Döhrn. Auslandsberichterstatterin und Öffentlichkeitsarbeiterin. Werbung für (West-) Deutschland im postkolonialen Asien und Afrika, In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte (2020), S. 16-46.
2018
Stahl, Heiner: Verkehrsnöte. Rhythmus, Taktung und Störung des Essener Straßenbahnverkehrs während des Ersten Weltkrieges, In: Sabine Schmolinsky/Diana Hitzke/Heiner Stahl (Hg.): Taktungen und Rhythmen. Raumzeitliche Perspektiven interdisziplinär, Berlin: DeGruyter, 2018, S. 143-172.
Stahl, Heiner: Propagandawissen und Stellenbesetzungen in der Presseabteilung der Direktorialkanzlei des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (1948-1949), In: medien & zeit. Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart 33 (2018) 1, S. 25-38.
2014
Stahl, Heiner: Vom Versprechen der Entlärmung. Geräuschkulissen im Sozialismus – Erfurt (1950-1975) Erfurt, In: Historische Anthropologie, 22 (2014) 3, S. 384-407.
Lindenberger, Thomas/Stahl, Heiner: Geschichtsmaschine Pop. Politik und Retro im vereinten Fernseh-Deutschland, In: Alexa Geisthövel/Bodo Mrozek (Hg.): Popgeschichte, Bd. 1 Konzepte und Methoden, Bielefeld : transcript, 2014, S. 227-247.
2013
Stahl, Heiner: Der Klang der postmodernen Großstadt, In: Gerhard Paul/Ralph Schock (Hg.): Der Sound des Jahrhunderts. Ein akustisches Porträt des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, Bonn/ Berlin : Bundeszentrale für politische Bildung, 2013, S. 558-563.
2009
Stahl, Heiner: Musikpolitik im geteilten Berlin – Die Aushandlungen des Hörfunksound und die Einarbeitungen von Popmusik 1962 bis 1973, In: Sascha Trültzsch/Thomas Wilke (Hg.): Heißer Sommer- Coole Beats. Zur Popmusik in der DDR und ihren medialen Repräsentationen, Frankfurt/M. : Peter Lang 2009, S. 159-178.
2008
Stahl, Heiner: Die Straßenkreuzungen des Pop, In: Michael Lemke (Hg.): Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948-1973), Berlin: Metropol 2008, S. 233-250.
2006
Stahl, Heiner: Skizze einer Stadtgeschichte des Klangs. Hörfunk, Popmusik und Jugendkultur im Ostberlin der späten 1960er Jahre, In: Uta Balbier/Christiane Rösch (Hg.): Umworbener Klassenfeind. Das Verhältnis der DDR zu den USA. Berlin : Ch. Links 2006, S. 247-260.
- Sound History
- Sinnes- und Geschmacksgeschichte
- Gastronomische Repräsentationen
- Raum/Zeitlichkeit
- Geschichte der Inszenierung von Wissenschaft am Beispiel von Ernst Haeckel, Popularisierungen von Naturwissenschaft und koloniale Blicktiefen
- Öffentlich-rechtlicher und privater Hörfunk/Fernsehen in der Mediendemokratie
- Netzwerke, Berufsbiografien und Entnazifizierungsgeschichten
- Stadtgeschichte und urbane Diskurse
- Mentalitätsgeschichte
- Advertising & Public-Relations-History
Eiskreationen zwischen Fürstenhof und Bürgerhaushalt: Kulturen des Wissens und des Genusses im Wandel vom 18. ins 19. Jahrhundert
Dieses Forschungsprojekt untersucht die Herstellung, Zubereitung, Darreichung und den Genuß von Speiseeis zwischen 1750 und 1850. Es fragt nach den Wissenstransfers und Praktiken der Distinktion, die sich in die Erzeugung, die Inszenierung und in den Genuß dieses Nachtisches eingeschrieben haben. Es geht erstens um die Verfahren der Distinktion, die an einer fürstlichen Tafel praktiziert werden und um deren Übernahmen und Abwandlungen in bürgerlichen Tischgesellschaften. Zweitens beleuchtet das Vorhaben die handwerkliche Dimension der Herstellung von Speiseeis und fragt nach den transregionalen Wissenstransfers, die Expertinnen und Experten, Konditorinnen und Konditoren, Köchinnen und Köche leisteten. Drittens untersucht die Studie Rezeptsammlungen und Kochbücher und verortet die durch Medien vermittelte und verstärkte Popularisierung von esskulturellem Wissen als Aspekt des bürgerlichen Bildungsverständnisses. Der vierte Strang unternimmt den Versuch, die von Jean Anthelme Brillat-Savarin (1825) angestellten Überlegungen zu gustatorischen Sinneserfahrungen mit zusätzlichen empirischen Daten, wie beispielsweise den Aktenüberlieferungen von Hofküchen und -konditoreien zu Speisefolgen, Verbrauch und Inventarlisten, auszuweiten und anhand von Ego-Dokumenten wie Tagebuchaufzeichnungen und Briefwechseln neu zu fassen. Das berührt fünftens die stoffliche Beschaffenheit von Speiseeis, welche sich über einen bestimmten Zeitraum von Gefrorenem zu Geschmolzenem verändert. Insbesondere hier berühren sich material culture und sensory history.
English version here.
Mehr zum aktuellen Forschungsprojekt erfahren Sie hier:
Eis schmeckt klasse! Hofkonditoreien und die Wissenstransfers bei der Zubereitung und des Genusses von Speiseeis (1770-1850); MDR Thüringenjournal, 2.3.2024, Tag der Archive, Stadtarchiv Erfurt, Min. 9.16-11.15, hier 10.45-11.03.
Mai 2022: DFG-Sachmittelbeihilfe/Eigene Stelle (GZ: STA 1101/5-1), (36 Monate Laufzeit). „Eiskreationen zwischen Fürstenhof und Bürgerhaushalt: Kulturen des Wissens und des Genusses im Wandel vom 18. ins 19. Jahrhundert.“ - 310.000 €, Laufzeit 1/2023-12-2025
Juni 2017: Staatsministerin für Kultur und Medien, Post-Doc-Projekt „Kontaktzone Bonn. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1949-1969)“ - 350.000 €, Laufzeit 10/2017-12/2021
Juni 2003: Eigenes Promotionsprojekt „Jugendradio im kalten Ätherkrieg (1962-1973)“ im Projektbereich IV „Massenmedien im Kalten Krieg“ des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, DFG-Mantelantrag (36 Monate Laufzeit, Prof. Dr. Thomas Lindenberger (Antragsteller), 90.000 €, Laufzeit 1/2004-12/2006
April 2022: Gerade-Henkel-Stiftung, zwei Promotionsprojekte zur Popularisierung und den Wissensräumen des Geschmacks von Speiseeis (1870-1950) - (36 Monate Laufzeit, Prof. Dr. Angela Schwarz, Antragstellerin).
Stadt macht Lärm. Geräuschkulissen, (Hör-)Erfahrungen und soziale Akustik in Erfurt, Essen und Birmingham (1880-1960) (Habilitationsprojekt)
Hören und die (Hör-)Erfahrung von Geräuschen in den drei Industriestädten Erfurt, Essen und Birmingham stehen im Blickpunkt dieses Forschungsprojektes. Dabei geht es um Diskurse, Praktiken und Wissensbestände sinnlicher Wahrnehmung und deren Wandlung in der Zeit zwischen 1880 und 1960. Lärm zu machen, wird dabei als eine Praxis verstanden, die Macht und Herrschaft bezeichnet. Sie kann ökonomisch, juristisch, medizinisch, sozial, kulturell, technologisch oder politisch ausgefüllt werden. Ihre Inhalte stammten aus Erfahrungen, Erinnerungen und Erlebnissen des Hörens. Diese schufen unterschiedliche Bestände von (Hör-)Wissen, das menschliches Verständnis von Lärm und Geräusch bis in die Gegenwart geprägt hat. Sie entstehen in Phonotopen, verlaufen auf Hörwegen und enthalten akustische Stoffe, die durch die gesellschaftlichen Aushandlungen mit entsprechenden Wertigkeiten aufgeladen sind. Deshalb sind sie nicht einfach numerische Werte von Schallenergie, die sich in einem Handlungs-, Arbeits- oder Vergnügungsraum oder zwischen Menschen bewegen. Dennoch wurde die soziale Dimension des Hörens, sich Stille-Wünschens und der Lärm-Erfahrung in den Entscheidungen lange Zeit konsequent ausgeblendet. Das förderte unter anderem die Standardisierung von Grenzwerten gerade einmal entlang von (Mindest-)Kriterien, die ökonomische Verwertungen und Gewinnmaximierungen kaum – oder nur mit zeitlichen Verzögerungen – einschränkten. Der Schutz von lärmenden Maschinen war lange Zeit gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtiger als der Schutz der Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern. Das Projekt erforscht entlang dieses Spannungsfeldes, wie sich konfliktreiche Aushandlungsprozesse um die verschiedenen akustischen Räume in einer Stadt entwickelten.
Zur weiteren Information finden Sie hier eine Leseprobe und einen Sammelbandbeitrag über Klanginseln und die (post-)moderne Großstadt (Paul/Schock 2013).
Rundfunksäulen und Lautsprecheranlagen
Die akustische Beherrschung des öffentlichen Raumes besaß während des nationalsozialistischen Regimes eine technologische, eine propagandistische und eine auf die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall zielende Dimension. Rundfunksäulen und Lautsprecheranlagen erzeugten dabei öffentliche ‚Hör-Räume‘. Zeitlich begrenzt, jedoch seriell wiederholbar, ließen sich die Bewohnerinnen und Bewohner zu Zuhörenden machen und zusammenschalten, wobei Zwang und Zustimmung diese Formierungen gleichermaßen begleiteten. Aus der abgelenkten, desinteressierten ‚Masse‘ der Menschen entstand ein lauschendes und Ansprachen vernehmendes ‚Volk‘. Die dahinterstehenden Motive und Interessenlagen von Kommunalpolitik, Unternehmen der Rundfunkindustrie sowie verschiedener Reichsministerien bilden den Kern der Untersuchungen. Das Vorhaben zeigt auf, welche (klang-)ästhetischen Vorstellungen für die Beschallung, Einstimmung und auditorische Beherrschung von Bürgerinnen und Bürgern während des NS-Regimes handlungsleitend und welche Wirkungen das auf Erfahrungen, Erwartungen und Erinnerungen des Hörens damit verbunden waren. Dabei tritt neben die Propaganda als bedeutsamer Faktor die wirtschaftliche Verwertung dieser akustischen Räume. Auf der anderen Seite traf das Angebot bei den Menschen durchaus auf Gegenliebe und eine damit verbundene Bereitwilligkeit, es zu nutzen. Die daraus resultierenden Handlungsspielräume für die verschiedenen Akteursgruppen werden als Teil einer komplexen Wechselwirkung zwischen dem Regime und anderen handlungstragenden Einzelpersonen, Organisationen und Firmen verstanden. Somit leistet das Projekt einen Beitrag zum Verständnis der nationalsozialistischen Herrschaft und ihrer Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung.
Rhythmen und Taktungen
Der Leipziger Nationalökonom Karl Bühler entwickelte 1896 in seinem Buch Arbeit und Rhythmus eine Vorstellung davon, welche Bedeutung zeitlich gerichtete und getaktete Bewegungen für Prozesse der Herstellung von Gütern beigemessen werden kann. Rhythmus ordnet demnach Zeit und Raum, verbindet Ähnliches und Gegensätzliches, reguliert Geschwindigkeiten und Abfolgen. Taktungen wiederum teilen Rhythmen in Abschnitte. Deren Wiederholung erlaubt die Kalkulation und Prognose bestimmter Vorgänge. Ausgehend von diesen rein technischen Vorgängen entwickelten sich weitergehende Vorstellungen von Rhythmus und Taktung als Symmetrie, Gleichmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit. Sie lassen sich interdisziplinär im Kontext ihrer zeitlichen, räumlichen, sozialen, kulturellen und kommunikativen Funktionen untersuchen. Im Kontext der Erfurter Raum-Zeit-Forschung nahmen 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche disziplinäre Perspektiven auf Phänomene von Rhythmus und Taktung in den Blick. Ihre Ergebnisse erschienen 2018 in einem Sammelband, der unter Beteiligung des Lehrstuhls in Person von PD Dr. Heiner Stahl herausgegeben wurde. Thematisch widmen sich die Studien kulturhistorischen, literaturwissenschaftlichen und medizinischen Betrachtungen von Rhythmen und Taktungen in einem raumzeitlichen Kontext. So werden etwa frühneuzeitliche Messekalender in Bezug auf Handels- und Jahreszeiten untersucht, die saisonale Erschließung von Tourismuszielen mit Modellen erklärt, psychiatrische Begutachtungen in Form von Behandlungsroutinen gedeutet, die Zeitlichkeit der Improvisation bei Jazzmusik analysiert oder die Unterbrechung von Taktungen im öffentlichen Verkehr durch Kriegseinwirkungen diskutiert.
Kontaktzone Bonn. Praktiken und Wissensbestände politischer Kommunikation in der bundesrepublikanischen Mediendemokratie (1949-1969)
Das Bundeskanzleramt war und ist eine Institution öffentlicher Kommunikation. In der Frühzeit der Bundesrepublik musste sich das Bundeskanzleramt seine Aufgaben, Strukturen, Prozesse und Kontakte erst schaffen. Mit ihnen festigte es sich einen Platz im Gefüge der sich zunehmend medial orientierenden Demokratie. In dem Rahmen und den darin aufgebauten Netzwerken agierte das Bundeskanzleramt und das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung im Zeitraum zwischen 1949 und 1969. Es waren die Schaltstellen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Dort kommunizierten die Ingenieure der Verlautbarung mit Zielgruppen in der Öffentlichkeit. Diese Schaltzentrale des Regierens ist bislang von der geschichtswissenschaftlichen Forschung wie ein Nicht-Gegenstand behandelt worden. Diese Studie zeigt, wie die Mentalitäten der Nachkriegsgesellschaft in Strukturen, in Praktiken und bei den im politischen Betrieb Handelnden zum Ausdruck kamen und welche Rückbezüge auf die staatliche Öffentlichkeitsarbeit in der Weimarer Republik und während des nationalsozialistischen Regimes gültig blieben. Eine Amerikanisierung dessen, was seit den 1870er Jahren in Preußen und im Deutschen Reich zu Wissensbeständen der staatlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Medienkampagnen und der Wirtschaftsreklame geronnen war, fand nicht statt. Das Grundgesetz zu bewerben, wie es derzeit anlässlich des 75. Jubiläums öffentlich geschieht, wäre weder 1959 oder 1969 irgendwem in den Sinn gekommen. Es ging darum, Reklame für Deutschland zu machen und dessen geografischen und mentalen Gehalte auf Westdeutschland engzuführen. Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung der Kontaktzone Bonn lenkt den Blick zum einen auf die Praktiken öffentlicher Meinungsgestaltung und zum anderen auf die professionellen Erfahrungen, die Vergangenheiten und die Entlastungsnarrative, die die Akteure wählten. Es veranschaulicht erstens aus einer anderen als der bislang üblichen Perspektive, wie die Westbindung in den 1950er Jahren verhandelt, politisch und medial präsentiert sowie gesellschaftliche verankert wurde. Zweitens schärft diese Studie die Notwendigkeit, die Kontinuitäten nationalsozialistischen Denk-, Diskurs- und Sprechfiguren in der parlamentarischen Demokratie der 1950er und 1960er Jahre weiter zu beforschen und zudem die vielfältigen Belastungen der Medien- und Presselandschaft, von Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffenden oder Zeitungsverlegerinnen und -verlegern grundsätzlich zu erörtern.
Das Forschungsprojekt untersucht die Praktiken und Vernetzungen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren. Es folgt einer Perspektive, die kultur- und medienhistorische Zugänge mit einer Mentalitätsgeschichte staatlicher Öffentlichkeitsarbeit verknüpft. Im Zentrum der Betrachtungen stehen das Bundeskanzleramt und das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Als titelgebende Ingenieure der Verlautbarung agierten dort Männer, und unterhalb der Führungspositionen der Abteilungen und der einzelnen Fachreferate traten zahlreiche Frauen als wissenschaftliche Hilfsarbeiterinnen in Erscheinung und fanden Eingang in die archivalische Überlieferung.
Die Pressemänner und die Medienfrauen konnten auf vielfältige Erfahrungswerte in der staatlichen Presse- und Informationsarbeit aus der Zeit des Deutschen Reiches zurückgreifen konnten – vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis zum Ende des nationalsozialistischen Regimes. Insbesondere die Erfahrungen aus den zwölf Jahren der Diktatur und ihrer staatlichen Medienlenkung flossen als Wissensbestände und erprobte Praktiken in das ein, was für die Zeit nach 1949 gerne als Wiederaufbau bezeichnet wird. Institutionell handelt es sich um Fortführungen. Weder in der noch jungen Bundesrepublik noch in deren Erwachsenenalter (nach 1969) entwickelte sich staatlicherseits eine Arbeit mit der Presse und der Öffentlichkeit, die den Gepflogenheiten eines liberalen und demokratischen Rechtsstaates sowie den Informationsbedürfnissen einer offenen und kritischen Mediengesellschaft Rechnung getragen hätte. Das musste alles immer wieder von Neuem erkämpft und abgerungen werden. Vielmehr wirkten bestehende Strukturen sowie Akteurinnen und Akteure weiter fort. Sie trafen auf Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Werdegängen, die im Zweifel bereits auf beträchtlich erfolgreiche Karrieren in der nationalsozialistischen Medienindustrie und Zeitungslandschaft zurückblickten, und die geflissentlich darauf bedacht waren, daran anzuknüpfen und sich darum bemühten, die neuen Bezeichnungen für Westdeutschland mit alten Erzählungen in Bezug zusetzen und mentalitätsgeschichtliche Blindstellen zu nähren. Die daraus resultierenden Prozesse der Ver- und Neuaushandlung von Pressearbeit und Kommunikation zwischen den Regierenden, den Medien und der Öffentlichkeit bilden den Kern der Forschungen, die Kontinuitäten im Übergang von der Diktatur zu einem Staat offenlegen und einordnen sollen, der dessen Bevölkerung sich das Demokratie-Sein – auch in der doppelt-deutschen Perspektive – mühsam erkämpfte.
Jugendhörfunk im kalten Ätherkrieg. Jugendstudio DT 64, s-f-beat und RIAS-Treffpunkt und die Herausbildung einer Klanglandschaft des Pop in Berlin (1962-1973)
Im Mai 1964 lief während des Deutschlandtreffens der Jugend in Ostberlin ein Sonderprogramm – DT 64. Der positive Eindruck, den diese Kooperation der DDR-Rundfunksender bei den Entscheidungsträgern der Partei hinterließ, führte dazu, dass die Sendezeit des Jugendhörfunks erweitert wurde und dieses den Namen Jugendstudio DT 64 erhielt. Sowohl der Sender Freies Berlin (SFB) als auch der Rundfunk im amerikanischen Sektor (RIAS) waren zu diesem Zeitpunkt noch weit davon entfernt, jugendliche Hörer innerhalb des Vorabendprogramms mit eigenen Sendungen anzusprechen. Der vorliegende Beitrag stellt dar, wie sich aus der Verbindung von Popmusik und Informationen für Jugendliche spezielle Magazinformate entwickelten. Dabei wird herausgearbeitet, wie sich die ideologische Konkurrenz, die den Medienmarkt Berlins prägte, bei der Werbung um die Zielgruppe Jugend fortsetzte. Popmusik und ihre programmliche Präsentation wurden zu einem Kommunikationsmittel des Kalten Krieges umgeformt. Popmusik erlangte in den 1960er Jahren eine wachsende Bedeutung für die Rundfunkstationen in Deutschland. Private Hörfunksender wie Radio Luxemburg oder so genannte Piraten-Sender forderten die öffentlich-rechtlichen Anstalten heraus, weil sie die Musik, die bei ihnen zum Einsatz kam, näher an den sich wandelnden Geschmäckern und Erwartungen der Zielgruppen positioniert hatten. Insbesondere in grenzüberschreitenden Medienlandschaften ergaben sich hieraus bemerkenswerte Konstellationen. Eine solche Anordnung war und blieb die Rundfunklandschaft Berlin nach 1945.
Mehr Informationen finden Sie in diesem Beitrag und im vollen Werk.
Radiointerview
Kontaktzone Bonn – Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit 1949-1969 | Interview mit Heiner Stahl
https://audio.radio-frei.de/podcast/Unterdessen/2023/04%20April%20%202023/kontaktzone_bonn.mp3
Sichtbarkeit
Rezension: Jansen, Thomas: Goebbels' Lehrlinge als Werber der Demokratie, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.1.2024, Rezension von Kontaktzone Bonn. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Rezension: Matthiesen, Helge: Studie in Schwarz und Weiß, Generalanzeiger Bonn, 16/17.3.2024, Journal und Wochenendbeilage, S. 2. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
2025
25.02.2025: Karl Wilhelm Ramlers Wirken in der Kontaktzone Berlin zwischen 1747 und 1798: Publizistische Tätigkeiten und Autor-Verleger-Beziehungen in der Volks- und Staatsbildung, Tagung: Ein Multitalent der Aufklärung: Karl Wilhelm Ramler (1725–1798), Gleim-Haus, Halberstadt, 24.02.2025 – 25.02.2025.
2024
16. 12. 2024 Eisgenuss an thüringischen Fürstenhöfen und Wege zur einer Geschmacks- und Wissensgeschichte der Speiseeisherstellung (1770-1850) PD Dr. Heiner Stahl (Erfurt) 16-18 Uhr, Landesgeschichtliches Kolloquium, Historisches Institut, Seminarraum, Fürstengraben 13, 07743 Jena
5.12.2024 Université Catholique de l'Ouest Angers
10:15-10:40 | Heiner Stahl, Drehbuchverfassungen. Belastete Produktionsbedingungen und die Nachgeschichten des Nationalsozialismus (1949/50-1963)
16.11.2024 Jakob Fugger Zentrum Universität Augsburg
11.45 Uhr Kochbücher und Küchenbewirtschaftungen. Ökonomien des Essens, des Medialen, des Aufschreibens, des Zeitlichen und des Repräsentierens (1770–1830
25.10.2024: Geschmackswissen und Küchenkunst: Esskulturen, Tafelordnungen und Repräsentationen im Hause Leuchtenberg (1800-1850), "Die Herzen der Leuchtenberg" − Erinnerungskultur(en) einer europäischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert, Bayerisches Nationalmuseum München, 23-26.10.2024
30.09.2024 Medienberatung als Kontaktzone. Die Zeitungs- und Buchverleger Voss & Sohn als Akteure preußischer Medien- und Pressepolitik (1770–1800), Tagung: Verlegerisches Handeln als aufklärerische Praxis – Christian Friedrich Voss (und Sohn) und die Literatur des 18. Jahrhunderts an der Freien Universität Berlin, 30.9-2.10.2024
12.06.2024: Wie klang Weimar im 19. Und 20. Jahrhundert, Vortrag im Stadtmuseum Weimar.
22.03.2024: Haeckel - Adventurer, Explorer and Scientist who shapes the Visual Knowledge of Colonial Experience, Ernst-Haeckel-Haus at the Friedrich Schiller University Jena in cooperation with the Centre for Science Studies of the German National Academy of Sciences Leopoldina and the "Ernst Haeckel (1834-1919): Edition of Letters
22.02.2024: Eating Ice Cream between 1780 and 1830: Urban Co-Temporalities, Courtly and Civic Cultures of Luxurious Food and Contested Gastronomical Spaces, Urban Co-Temporalities. Historical and Theoretical Approaches, 21-23 February 2024, Campus University of Erfurt,
2023
06.12.2023: Geräuschkulissen. Perspektiven der Sound Studies und Sound History, Universität Wien, Kolloquium des Historischen Seminars und Verleihung des Wiener Preises für Stadtgeschichtsforschung 2023
29.11.2023: Dr. Wolfgang Glaesser: Ein privilegierter Exilant in Österreich und der Schweiz (1934-1950). Exil in Österreich: 1918–1938 Österreichische Gesellschaft für Exilforschung, Exilbibliothek im Literaturhaus, Institut für Zeitgeschichte 29-30.11.2023
27.04.2023: Das Phonotop der Kundgebung und die erschossenen Arbeiter der Gussstahlfabrik. Zur akustischen Straßenpolitik während des Ruhrkampfes und der Besatzungszeit in Essen 1919-1923, Kommunikationsraum Straße. Vom Kirchplatz zur Montagsdemonstration – neue Perspektiven, Verein zur Förderung der Zeitungsforschung in Dortmund e.V.) Dortmund 27./28.04.2023
16.04.2023: Veilchenaromen. Vom Duft zum Geschmacksstoff von Speiseeis. Natürliche Aromen und die Zubereitung von Desserts in Kochbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts, Kochkulturmuseum Österreich, Tage der historischen Kochkultur, Krahuletz-Museum, Eggenburg/Österreich, 14-16.04.2023. www.kochkulturmuseum.at/tage-der-historischen-kochkultur-2023/
12.04.2023: Ingenieure der Verlautbarung: Roland Krug zu Nidda und Günter Diehl in der Zweigstelle Vichy. Paris als Standort der deutschen Diplomatie (1868 bis heute) Workshop am Deutschen Historischen Institut Paris
in Kooperation mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Paris, 12./13. April 2023
24.02.2023: Das Presse- und Informationsamt in der Kontaktzone Bonn. Die Arbeit mit und in Rundfunk und Fernsehen zwischen 1949 und 1969, Strategien des Temporären, Legitimation des Dauerhaften. Die Konsolidierung der Bonner Republik in NRW, 24.02.+25.02.2023 Haus der Universität Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf
2022
26.10.2022: Kontaminierte Außendarstellungen. Die Abteilung Ausland des Presse- und Informationsamtes und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit im Ausland, IfZ/ZZF/Bundesarchiv, Die zentralen deutschen Behörden und der Nationalsozialismus. Abschlusstagung 25./26.10.2022, Akademie der Künste Berlin.
29.9.2022: Günter Diehl: Ingenieur der Verlautbarung in Brüssel, Vichy und Bonn (1939–1969), Nationalsozialismus und internationale Öffentlichkeit (Benno Nietzel/Norman Domeier), Ruhr-Universität Bochum, 28./29.9.2022.
17.6.2022: Zeitungsmacherinnen und -macher zwischen Literarischen Salons und Literarischen Büros (1785-1815), "Political Journalism between Media Change and Democratization from the 17th to the 21th century, Universität Bayreuth.
2021
2.7.2021: Das Geschmackswissen des Gefrorenen. Hofkonditoreien, Kochbücher und die Herstellung von Speiseeis um 1800, International Conference Food-Media-Senses, Universität Marburg 1-2.7.2021
27.5.2021: Das Geräusch-, Geruchs- und Geschmackswissen von Stadtärzten in der Zwischenkriegszeit. Immissionskonflikte, Bürgerbeschwerden und Begutachtungen (1918-1938/39), Workshop Sinnes_Räume, Innsbruck.